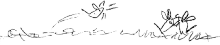Als Entdecker des Degus gilt der in Chile lebende Jesuitenpater Juan Ignacio Molina (in der Literatur findet man ihn auch unter dem italienischen Synonym Giovanni Ignazio Molina). In seinem 1782 erschienen Werk "Ensayo sobre la historia natural de Chile" (zu deutsch "Versuch der Naturgeschichte von Chile") hielt er den Degu für die Nachwelt fest und klassifizierte ihn als Sciurus degus. Sciurus ist die wissenschaftliche Gattungsbezeichnung der Hörnchen. Bekanntester Vertreter dieser Gattung ist unser Eichhörnchen, Sciurus vulgaris.
Als Entdecker des Degus gilt der in Chile lebende Jesuitenpater Juan Ignacio Molina (in der Literatur findet man ihn auch unter dem italienischen Synonym Giovanni Ignazio Molina). In seinem 1782 erschienen Werk "Ensayo sobre la historia natural de Chile" (zu deutsch "Versuch der Naturgeschichte von Chile") hielt er den Degu für die Nachwelt fest und klassifizierte ihn als Sciurus degus. Sciurus ist die wissenschaftliche Gattungsbezeichnung der Hörnchen. Bekanntester Vertreter dieser Gattung ist unser Eichhörnchen, Sciurus vulgaris.
Diese Einordnung war, wie sich später herausstellte, nicht ganz richtig, denn der Degu gehört heute zu einer eigenen Gattung innerhalb der Stachelschweinverwandten. Dennoch gibt es durchaus einige Ähnlichkeiten im Verhalten zwischen Degus und Hörnchen, dass man dem Jesuitenpater durchaus eine gute Beobachtungsgabe zuschreiben darf.
Der Degu wird heute zu den Nagetieren gezählt und gehört in die Familie der Trugratten (Octodontidae). Der britische Forscher George Robert Waterhouse stellte den Degu 1848 in die Gattung Octodon (Tremblay 2005), die auch der Familie der Trugratten ihren Namen gab. Der Name Octodon besteht aus dem lateinischen Wort octo, was "acht" bedeutet und dem griechischen Wort odoús (Genitiv-Form odóntos) für "Zahn" und bezieht sich auf die Form der Backenzahn-Kauflächen. Kurioserweise ist dieses Merkmal gerade bei den Degus nicht typisch ausgeprägt. Die Kauflächen der Degus sind ziemlich asymetrisch, ganz im Gegensatz zu anderen Trugrattenarten wie Aconaemys spp. (Felsenratten) oder Spalacopus spp. (Cururos), wessen Kauflächen die Form einer symmetrischen Acht aufweisen (Hutterer 1994). Der Name Degu stammt von dem araukanischen Wort dewü (Simpson 1941). Die Araukaner sind indianische Ureinwohner von Südchile.
 Der Degu ist ein 17 bis 21 cm langes Nagetier mit einem 8 bis 14 cm langen Schwanz (Redford & Eisenberg 1992) und wiegt zwischen 170 und 300 g (Woods & Boraker 1975). Über das Gewicht von wildlebenden Degus gibt es unterschiedliche Angaben. Häufig genannt wird ein Gewicht zwischen 140-160 g (Meserve et al. 1993) oder zwischen 160 und 200 g (Ebensperger 2001; Ebensperger & Hurtado 2005a; Kenagy et al. 2002, 2004). Dabei dürfte es sich vermutlich aber um Gewichtsangaben von subadulten (noch nicht ausgewachsenen) Degus handeln, wie Studien von Le Boulengé & Fuentes (1978) und Meserve et al. (1993) vermuten lassen, denn gemäss Meserve et al. (1993) sind erwachsene Degus besonders beliebte Beute und haben keine lange Lebenserwartung, während junge Degus eine grosse Überlebenschance haben, weshalb subadulte Tiere zeitweise in Degupopulationen dominieren dürften. Dies scheinen auch die Zahlen von Le Boulengé & Fuentes (1978) zu bestätigen, welche in den Herbstmonaten (Februar und März) für erwachsene Tiere von zwei Studiengebieten ein Durchschnittsgewicht von 202 bzw. 215 g ermitteln konnten, während die Tiere im Frühling bloss noch 196 bzw. 185 g wogen. In Gefangenschaft werden Degus etwa 5 bis 8 Jahre alt (Lee 2004), können aber bis zu 12 Jahre alt werden (persönliche Mitteilung S. Blome).
Der Degu ist ein 17 bis 21 cm langes Nagetier mit einem 8 bis 14 cm langen Schwanz (Redford & Eisenberg 1992) und wiegt zwischen 170 und 300 g (Woods & Boraker 1975). Über das Gewicht von wildlebenden Degus gibt es unterschiedliche Angaben. Häufig genannt wird ein Gewicht zwischen 140-160 g (Meserve et al. 1993) oder zwischen 160 und 200 g (Ebensperger 2001; Ebensperger & Hurtado 2005a; Kenagy et al. 2002, 2004). Dabei dürfte es sich vermutlich aber um Gewichtsangaben von subadulten (noch nicht ausgewachsenen) Degus handeln, wie Studien von Le Boulengé & Fuentes (1978) und Meserve et al. (1993) vermuten lassen, denn gemäss Meserve et al. (1993) sind erwachsene Degus besonders beliebte Beute und haben keine lange Lebenserwartung, während junge Degus eine grosse Überlebenschance haben, weshalb subadulte Tiere zeitweise in Degupopulationen dominieren dürften. Dies scheinen auch die Zahlen von Le Boulengé & Fuentes (1978) zu bestätigen, welche in den Herbstmonaten (Februar und März) für erwachsene Tiere von zwei Studiengebieten ein Durchschnittsgewicht von 202 bzw. 215 g ermitteln konnten, während die Tiere im Frühling bloss noch 196 bzw. 185 g wogen. In Gefangenschaft werden Degus etwa 5 bis 8 Jahre alt (Lee 2004), können aber bis zu 12 Jahre alt werden (persönliche Mitteilung S. Blome).Chile bietet, eine atemberaubende Landschaft, welche geprägt ist von extremen Gegensätze und einer Vielzahl an unterschiedlichen Vegetations- und Klimazonen.
Das Land erstreckt sich über 4300 km in der Länge und ist aber durchschnittlich gerade mal 180 km breit, an der schmalsten Stelle 90 km, an der breitesten 400 km und weist eine Fläche von 757'000 qkm auf (Cozzi & Asal 1998; Hörtreiter 2006). Vereinfacht gesagt besteht Chile aus drei Längszonen. Zwei parallele Gebirgszüge verlaufen von Norden nach Süden, die Küstenkordillere (Cordilliera de la Costa) im Westen und die höheren Anden (Cordilliera de los Andes) im Osten. Dazwischen liegt das grosse zentrale Längstal (Valle Longitudinal). Im Norden bildet das Längstal eine Hochebene, in welcher sich die trockene Atacamawüste befindet. Die Küstenkordilliere ist hier ziemlich breit, wird aber gegen Süden schmaler, bis sie bei Puerto Montt in den Pazifik stürzt und sich in Form von Inselgruppen fortsetzt. Ebenfalls bei Puerto Montt tritt das Längstal ans Meer und setzt sich unter Wasser als Kanal gen Süden fort. Dabei treten die Anden ans Meer (Stange 1914; Cozzi & Asal 1998; Hörtreiter 2006).
Durch die grosse Längenausdehnung kommen nahezu alle Klimazonen vor; tropisches Klima fehlt allerdings. Im Norden befinden sich äusserst trockene Wüsten- und Steppengebiete, im Hochland der Anden dominiert das extreme und rauhe Klima der Puna. In Mittelchile finden sich mediterane, gemässigte und äusserst fruchtbare Landstriche, weiter südlich nehmen die Niederschläge und Wälder zu. Subtropische, immergrüne Regenwälder und später sommergrüne Nadelwälder bestimmen nun die Landschaft. Erst ganz im Süden gegen Osten weichen diese Wälder und machen baumlosen Grassteppen platz, westlich findet man dagegen die Tundra.
Über Geschichte und Weg der Degus nach Europa ist relativ wenig bekannt.
Laut Sporon und Mettler (2002) gelangten 1964 zwanzig Degus in die USA, die in der chilenischen Ortschaft Lampa gefangen wurden. Von diesen sollen die meisten der in amerikanischen Institute gehaltenen Degus stammen. Über den Tierpark Berlin-Friedrichsfelde (damals DDR) sollen dann zwei Importe aus den USA nach Europa gelangt sein, auf diese viele Degus an deutschen Instituten zurückgehen sollen. Da sich die Degus im Tierpark gut vermehrten, wurden mehrfach kleine Serien überzähliger Tiere über eine Berliner Zoohandlungen abgegeben und gelangten so in Liebhaberhände (Haensel 1983).
Im Sommer 1967 gelangten drei Degupärchen, ein Geschenk eines chilenischen Instituts, nach London ins Wellcome Institute. Die Tiere lebten sich gut ein, erwiesen sich erstaunlicherweise als sehr unkompliziert, und einfach zu vergesellschaften. Doch entwickelten bald die meisten der Degus Linsentrübungen, zeigten aber keine der sonst typischen Merkmale von Diabetes melitus (Weir 1970). Ob von diesem Bestand Tiere in private Hände gelangten ist allerdings unklar.
Verbreitung in Europa. Anfangs der neunziger Jahre waren Degus noch ziemlich unbekannt. Zu diesem Zeitpunkt gab es kaum deutsche Literatur über Degus; deren Haltung war ein Experiment. Ende der neunziger Jahre hat sich die Situation gewandelt. Mit dem Erscheinen mehrerer Degubücher und der Behandlung der Degus in deutschsprachiger Fachliteratur, aber auch durch vermehrte Publikationen in Zeitschriften und Zeitungen rückte der Degu mehr und mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Zur gleichen Zeit nahmen auch Deguvermittlungen zu, es ereigneten sich erste Notfälle, das heisst, es kam zu Vermittlungen von grossen Degugruppen, die meist durch unkontrollierte Vermehrung zustande kamen. Diese steigende Popularität zog weitere unschöne Folgen nach sich und eine Wende ist nicht in Sicht: Baumärkte nahmen Degus in ihr Sortiment auf und durch die stetige Vermehrung häufen sich Farbmutationen, welche wohl als Indikator für einen noch bevorstehenden Farben-Boom betrachtet werden dürfen, welcher allerdings jetzt schon tendentiell spürbar ist. So wird nicht nur die Nachfrage nach blauen Degus grösser, sondern auch Schecken rücken mehr in den Fokus der Begierde unwissender Tierhalter. Dass gerade bei solchen Farbmutationen eine Vermehrung gefördert wird, die negative Konsequenzen auf die Vitalität und den Charakter nachfolgender Degugenerationen haben könnte, ist vermutlich den wenigsten bewusst. Die Folgen einer solchen Zucht mit schlechter Selektion (bzw. mit falschen Zuchtschwerpunkte) kann nur erahnt werden. Geringere Lebenserwartung, Erbkrankheiten und eine schlechte Sozialverträglichkeit unter Artgenossen könnten mögliche Folgen sein, ähnlich wie dies heute bei den Rennmäusen weit verbreitet ist. Nur eine gezielte Förderung einer seriöser Zucht, welche auf gesunden Zuchtlinien basiert und durch entsprechendes, solides Fachwissen des Züchters, welches sich nicht bloss auf Forenwissen und Infos aus dem Internet, sondern hauptsächlich auf Erfahrungen von professionellen Züchtern und Fachliteratur stützt, könnte dem Einhalt gebieten.
Die zwei grössten Kolonien von in Gefangenschaft lebenden Degus befinden sich in Vermont (USA), University of Vermont, die grösste Kolonie in den USA und in Santiago de Chile am Instituto de Medicina Experimental del Servico Nacional de Saludad der Universidad de Chile (Woods & Boraker 1975). Weitere Institute die Degus halten sind das Wellcome Institute (Wellcome Trust) in London oder die Universität Magdeburg (Deutschland).
Degus haben in vergangener Zeit in der Forschung an Bedeutung gewonnen, denn sie lassen sich einfach und schnell an Laborbedingungen gewöhnen und sind als tagaktive Nagetiere ein interessantes Studienobjekt (Kooij & Rietveld 1987). Ihre lange Tragzeit im Vergleich zu ihrer kleinen Körpergrösse, ihr Sozialverhalten und ihre lange Lebenserwartung sind weitere, für die Forschung attraktive, Merkmale.
Die Forschungsgebiete, in denen Degus eingesetzt werden sind sehr vielfältig. Zu den vielen Forschungsfeldern gehören unter anderem die Chronobiologie (Labyak & Lee 1995; Lee 2004; Ocampo-Garcés et al. 2005), Ernährungsphysiologie und Futterverhalten (Bozinovic 1995; Bozinovic et al. 1997; Meserve 1981; Meserve et al. 1983; Simonetti & Montenegro 1981; Veloso & Bozinovic 1993, 2000), Ethologie (Iriate et al. 1989; Le Boulengé & Fuentes 1978; Meserve et al. 1993, 1996, 2003;) Soziobiologie (Ebensperger 1998, 2001; Ebensperger & Blumstein 2006; Ebensperger & Bozinovic 2000b; Ebensperger & Wallem 2002; Ebensperger et al. 2002, 2004), Neugeborenenforschung (Reynolds & Wright 1979) und Neurobiologie (Braun & Scheich 1997). Weitere Forschungsgebiete werden in Gneiser (2006: 2) beschrieben.
Degu Ratgeber online: http://degu.re4.ch/ratgeber/allgemeines_namen.html (Stand: 31. Dez. 2007)