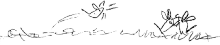Der Degu ist eines der häufigsten Säugetiere Mittelchiles (Woods & Boraker 1975). Mit Dichten von über 300 Tieren pro Hektare ist er in der Region um Santiago am dichtesten verbreitet (Zunino & Vivar 1986). Er bevorzugt offene Landschaften und meidet dichte Vegetation, sucht aber dennoch den Schutz von Sträuchern gegen Feinde (Iriate et al. 1989; Lagos et al. 1995; Le Boulengé & Fuentes 1978). Sein Lebensraum ist daher sehr ähnlich wie jener der Wildkaninchen in ihrer ursprünglichen Heimat in Spanien (Jaksić & Soriguer 1981).
Revier. Das Revier einer Degugruppe besteht laut Fulk (1976) aus mehreren Baue, welche unterschiedlich häufig benutzt werden. Viele von ihnen sind oberirdisch mit Trampelpfaden untereinander verbunden. Weitere Trampelpfade führen zu den Futterplätzen, Stellen an denen die Vegetation kurz abgefressen ist. Dabei grasen sie etwa in einem Radius von 5 Meter von ihren Baue entfernt (Fuentes et al. 1983). Viele der oft benutzten Baue weisen in der Nähe des Eingangs einen Sandbadeplatz und einen Haufen auf, bestehend aus Steine, Zweigstücke und Kuhdung. Die Haufen werden von dem Männchen mit weiteren Elementen aufgehäuft, wenn es erfolgreich einen Eindringling vertrieben hat. Bei der Zerstörung eines solchen Hügels verlor das betroffene Männchen seinen hohen Rang in der Gruppe. Daher vermutet Fulk (1976), dass es sich bei diesen Haufen um eine Art Statussymbol handeln könnte.
Der Degubau. Degus graben ihre Baue gerne unter Sträuchern, unter Schotterhügeln oder in der Nähe von Felsen (Le Boulengé & Fuentes 1978; Woods & Boraker 1975). Dabei wählen sie für ihre Baue bevorzugt Standorte unter Sträuchern wie Muehlenbekia hastulata oder Colliguaya odorifera und meiden dagegen Sträucher wie Acacia caven, Baccharis rosmarinifolia, Lithraea caustica oder Quillaya saponaria. Muehlenbekia und Colliguaya unterscheiden sich von den anderen Sträuchern, dass ihr Blattwerk immer bis zum Boden reicht und sie so einen besseren Schutz bieten als die anderen Sträucher (Iriate et al. 1989; Le Boulengé & Fuentes 1978). Neben ihren Hauptbaue legen Degus entlang ihrer Trampelpfade maximal alle 4 bis 5 Meter einfache temporäre Baue ohne irgendwelche Kammern und verzweigende Gänge an (Le Boulengé & Fuentes 1978), wie das auch von mongolischen Rennmäusen bekannt ist (Scheibler et al. 2006). Die Gänge haben einen Durchmesser von 8-10 cm. Sie werden in 15-60 cm Tiefe gegraben und können eine totale Länge von 2 Meter oder mehr aufweisen (Ebensperger & Bozinovic 2000). Degus graben unregelmässig, aber während allen Jahreszeiten. Die Grabeaktivität macht mit 0,2 % allerdings nur einen geringen Anteil der gesamten Aktivität der Degus aus (Ebensperger & Hurtado 2005a). Beobachtungen von Ebensperger und Bozinovic (2000a) zufolge graben Degus vor allem im Winter, wenn der Boden weicher ist.
Ernährung. Degus fressen oberirdisch und selten klettern sie in die unteren Äste von Sträuchern (Heinemann 1980; Woods & Boraker 1975). Im Vergleich zu anderen chilenischen Nagern sind sie aber schlechte Kletterer, obwohl selbst die vom Körperbau sehr ähnlichen Wald-Degus (Octodon bridgesi) sich deutlich gewandtere Kletterer erwiesen (Gallardo-Santis et al. 2005). Sie ernähren sich etwa zu 75 % vom Blättern und zu 25 % von Samen, Insekten spielen mit einem Anteil von weniger als 1 % eine unbedeutende Rolle (Meserve 1981; Meserve et al. 1983; Silva 2005). Degus halten keinen Winterschlaf, legen aber Vorräte an (Woods & Boraker 1975). Es gibt allerdings deutliche geografische Unterschiede bei der Zusammensetzung der Ernährung.
Bei Untersuchungen von Meserve (1981) an einer Degupopulation im Fray Jorge Nationalpark (250 km nördlich von Santiago) zeigten die untersuchten Degus eine Präferenz für strauchige Pflanzen. Eigenen Berechnungen zufolge, basierend auf Meserves Datenmaterial, ernähren sich die Degus zu 46,4 % von Strauchblättern, 15,8 % von Strauchsamen, dagegen aber nur zu 29,6 % von Kräuter- und Grasblättern und 8,1 % von deren Samen. Zu den meistgefressenen Pflanzen gehören unter anderem Blätter von Chenopodium petiolare (Gänsefussgewächs), verschiedene Grasblätter, Reiherschnabel (Erodium cicutarium; Storchschnabelgewächs), Baccharis sp. (Korbblütlengewächs), Porlieria chilensis (Jochblattgewächs) und Samen von Porlieria chilensis, verschiedenen Gräsern und Wegerich (Plantago sp.).
Dagegen zeigten Degus der gemässigten, mediterranen Region um Santiago andere Präferenzen bei der Futterwahl. In La Desha (20 km nordöstlich von Santiago) untersuchte Degus zeigten eine Präferenz für Reiherschnabel (Erodium cicutarium) und Gräser (hauptsächlich Bromus sp.) in den feuchten Winter- und Frühlingsmonaten (Mai-November) (Meserve et al. 1983). Blätter von Sträuchern (hauptsächlich Acacia caven) frassen sie dagegen vor allem in den trockenen Sommer- und Herbstmonaten (Dezember-April). Wahrscheinlich fressen Degus Blätter und Rinde des Espino (Acacia caven) um ihren Wasserbedarf während den trockenen Sommermonate zu decken, wenn saftige Kräuter- und Grasfluren austrocknen.
Die Trockenperiode im Sommer stellt für sie eine kritische Zeit dar. Ausgetrocknete Pflanzen und der Mangel an energiereichem und qualitativ hochwertigem Frischfutter führt zu einem Nahrungsengpass (Bozinovic 1995; Le Boulengé & Fuentes 1978). Die Degus begegnen dieser Zeit durch eine Anpassung ihres Fressverhaltens. Sie können den niedrigen Energiegehalt der ausgetrockneten Pflanzen und den faserreichen Strauchblätter kompensieren, indem sie ihre Futteraufnahme erhöhen, das Futter besser verdauen und ihren Stoffwechsel senken. Durch diese Massnahmen ist es ihnen möglich selbst bei schlechtem Futter ihre Lebensfunktionen aufrecht zu erhalten (Bozinovic 1995).
Bemerkenswerterweise unterliegt der Saatgehalt starken saisonalen Schwankungen. Untersuchungen von Degupopulationen im Fray Jorge Nationalpark und in La Desha haben gezeigt, dass der Saatgehalt zwischen 6 % (in Fray Jorge) beziehungsweise unter 5 % (in La Desha) im Winter (Mai-August) und über 60 % im Sommer (November-Januar) variiert (Meserve 1981; Meserve et al. 1983).
Kenagy et al. (2004) erwähnen, dass die in ihrer Studie untersuchten Degus in Quebrada de la Plata (30 km westlich von Santiago) sich von dem immergrünen Senecio adenotrichius ernährten, welcher ihnen ausserdem als Versteck und Schattenspender diente.
In Chile gelten Degus als Schädlinge, da sie in Lebensräumen nahe von kultiviertem Ackerland auch Kulturpflanzen beschädigen (Woods & Boraker 1975). Zu ihren bevorzugten Pflanzen gehören Feigenkakteen (Opuntia sp.), Maiskolben und Weintrauben. Zudem beschädigen sie auch Weinreben. Allerdings kommt es beim Degu nicht zu Masseneinwanderungen von weit entfernten Populationen, wenn sich die Populationen aufgrund eines reichlichen Nahrungsangebots stark vermehren, wie das bei anderen einheimischen Nagetierarten der Fall ist (Péfaur et al. 1979).
Fortpflanzung. Die Fortpflanzung der Degus in der Wildnis ist saisonl und abhängig von der Verfügbarkeit von energiereicher, qualitativ hochwertiger Nahrung (Bozinovic 1995; Kenagy et al. 2002b; Ebensperger & Hurtado 2005a). Im Norden, bei Fray Jorge pflanzen sich die Degus von Juli-November fort (Meserve 1981). In den südlichen Teilen ihres Verbreitungsgebietes in Mittelchile paaren sie sich dagegen im Spätherbst (Mai-Juni) und bringen ihren ersten Wurf im Spätwinter (September-Oktober) zur Welt. Aufgrund des postpartum Oestrus kann es zu einer anschliessenden, erneuten Paarung kommen mit einem zweiten Wurf im Frühsommer (Dezember-Januar) (Ebensperger et al. 2002; Le Boulengé & Fuentes 1978).
Aufzucht der Jungen. Deguweibchen ziehen ihre Jungen gemeinsam in grossen, gemischten Würfen auf, welche aus eigenem und fremdem Nachwuchs bestehen (Ebensperger et al. 2002; Fulk 1976). In der Wildnis organisieren meist verwandte Deguweibchen in Gruppen von 2 bis 6 Tieren, verteilt auf etwa 3 Nestplätze, die gemeinsame Aufzucht ihrer Jungen (Ebensperger et al. 2004). Die Vorteile der gemeinsamen Jungenaufzucht liegen in der Teilung der Arbeit und damit verbunden einer besseren Überlebenschance des Nachwuchs.
Erstaunlich ist ferner das Zusammenleben von tagaktiven Degus und nachtaktiven Chinchillaratten (Abrocoma bennetti) im selben Bau, welches von Fulk (1976) erwähnt wurde. Das Zusammenleben der beiden Arten beschränkt sich dabei nicht bloss auf die Benutzung des selben Baus, Fulk fand in einem ausgegrabenen Bau eine erwachsene Degumutter zusammen mit Chinchillaratten- und Degu-Nachwuchs in einer Kammer und in einer anderen Kammer eine Chinchillarattenmutter zusammen mit Jungen der beiden Arten, was auf eine gemeinsame Aufzucht der Jungtiere hindeutet.
Sozialstruktur.
Degus sind sehr soziale Tiere und leben in Familiengruppen bestehend aus 2 - 5 Weibchen und 1 - 2 Männchen (Woods & Boraker 1975; Fulk 1976). Mehrere Familien bilden eine lockere Kolonie, wobei jede Familie ein eigenes Revier und einen eigenen Hauptbau hat.
Solche Kolonien können ein paar Hundert Degus umfassen. Während die Standorte der Guppenterritorien unverändert bleiben, variiert die Zusammensetzung der Gruppen saisonal. Mit Ausnahme der Hauptbrutzeit bewegen sich die Gruppenmitglieder frei zwischen den verschiedenen Gruppen (Ebensperger & Walem 2002; Le Boulengé & Fuentes 1978). Wenn fremde Degus in ein neues Territorium eindringen baden sie oftmals ausgiebig in den Sandbadestellen von jener Degugruppe, um deren Gruppenduft anzunehmen (Fulk 1976). Dank dem neuen Gruppenduft werden sie von der neuen Gruppe besser akzeptiert und weniger attackiert als Tiere mit einem unverwandten Gruppenduft.
Aufgrund einer instabilen Sozialstruktur während dem Beginn der Brutzeit, entwickeln die männlichen Degus ein aggressives Verhalten gegenüber anderen Männchen um Territorien zu bilden, Anspruch auf Weibchen zu erheben und Harems zu bilden. Während dieser Harem-Bildung haben die männlichen Degus ausserdem einen erhöhten Testosteronspiegel, welcher vermutlich einen bedeutenden Einfluss auf ihr Verhalten und ihre Aggressivität hat. Sobald allerdings die Territorien gebildet sind, sinkt der Testosteronspiegel wieder auf sein normales Niveau und aggressive Verhaltensweisen nehmen wieder stark ab (Ebensperger 2001; Soto-Gamboa 2005).
Verhalten. Fulk (1976) beschreibt ein vielfältiges Repetoire an Verhaltensmustern, das in etwa dem entspricht was viele Deguhalter auch an ihren eigenen Degus schon beobachten konnten: freundschaftlicher Nasen-Nasen-Kontakt, gegenseitige Fellpflege, das Dominanz anzeigende Besteigen, aber auch eher aggressive Verhaltensmuster wie Ausschlagen mit den Hinterbeinen, trommeln mit den Vorderbeine oder Schwanz wedeln. Die Tiere innerhalb der Gruppe sind untereinander in der Regel sehr friedlich. So werden auch keine Jungtiere von Artgenossen aus der selben Gruppe getötet, wie es z.B. bei anderen Tierarten der Fall ist (Ebensperger 2001).
Alarmrufe. Degus warnen ihre Artgenossen vor Gefahren und Feinden durch Alarmrufe. Dabei scheinen sie über Alarmrufe gezielt Informationen über die Art der Gefahr übermitteln zu können, da sie je nach Feind andere Alarmrufe verwenden (Ebensperger et al. 2006). Gewarnte Tiere suchen, sobald sie den Alarmruf hören, unverzüglich im nächsten Bau Zuflucht oder sie nehmen eine aufrechte Haltung ein und verharren aufmerksam in der Nähe eines Baueingangs (Fulk 1976). Le Boulengé & Fuentes (1978) berichten, dass Degus je nach Grösse des Beutegreifers unterschiedlich reagieren. So fliehen sie bei grossen Raubvögeln wie dem Rotrückenbussard (Buteo polysoma) unverzüglich in den nächsten Bau und geben dabei schrille Alarmrufe von sich, welche sich von Kolonie zu Kolonie übertragen. Bei kleinen Greifvögeln wie dem Chimango (Milvago chimango) versteckt sich nur ein Teil der Tiere, ohne dass dabei Alarmrufe ausgestossen werden.
Feinde. Degus sind häufig in Mittelchile und dienen den einheimischen Raubtieren als eine sichere und stabile Futterquelle (Jaksić & Soriguer 1981). Zu den Hauptfeinden der Degus gehören unter anderem der Virginia-Uhu (Bubo virginianus), der Patagonien-Sperlingskauz (Glaucidium nanum), der Rotrückenbussard (Buteo polyosoma), der Wüstenbussard (Parabuteo unicinctus), der tagaktive Blaubussard (Geranoaetus melanoleucus), der Culpeofuchs (Pseudalopex culpaeus) und der Graue Andenfuchs oder Chilla (Pseudalopex griseus) (Jaksić et al. 1981, 1992; Meserve et al. 1996; Schlatter et al. 1980). Weissschwanzaare (Elanus leucurus) dagegen fressen nur die Jungtiere, da ihnen erwachsene Degus zu gross sind (Schlatter et al. 1980). Woods und Boraker (1975) erwähnen als weitere Feinde noch die Schleiereule (Tyto alba), die Sumpfohreule (Asio flammeus), beides nachtaktive Raubtiere. In kleinen Mengen werden Degus auch von dem Buntfalken (Falco sparverius) und dem Kaninchenkauz (Athene cunicularia) konsumiert (Jaksić et al. 1981, 1992).
Schlangen wie Philodryas chamissonis oder Tachymenis peruviana gehören nicht zu den typischen Feinden der Degus, denn sie ernähren sich hauptsächlich von Fröschen und Eidechsen (Jaksić et al. 1981), wobei Philodryas chamissonis im Gegensatz zu Tachymenis peruviana auch kleinere Mengen an Degus und jungen Kaninchen konsumiert (Simonetti & Fuentes 1982). Ausserdem erwähnen Jaksić & Soriguer (1981), dass in Südspanien Schlangen in die Baue von Wildkaninchen eindringen und die jungen Kaninchen in dem Bau fressen. Es wäre denkbar, dass dieses Verhalten auch von chilenischen Schlangen angewendet wird.
Lebenserwartung. Freilebende Degus werden nicht sehr alt. Der starke Einfluss von Feinden auf ihre Lebensweise reduziert ihre Lebenserwartung. Vor allem erwachsene Tiere sind davon betroffen, welche als Beute beliebt sind. Die Jungen dagegen sind gemäss Meserve et al. (1993) wenig bedroht und weisen, wie das bei den Stachelschweinverwandten verbreitet ist (Kraus et al. 2005), eine geringe Sterblichkeitsrate auf. Meserve et al. (1993) untersuchten in ihrer Studie die Überlebensrate von Degus mit oder ohne Feind-Einwirkung. Dabei zeigte sich, dass gerade mal etwa 10 % der Degus länger als 6 Monate und gerade mal 0,7 % der Degus länger als 15 Monate überlebten. Bei Degus, die von Feinden geschützt lebten war die Überlebensrate nach 15 Monaten mit 5,7 % schon bedeutend höher. Dieser starke Einfluss der Feindesgefahr wirkt sich auch auf das Verhalten der Degus aus. So legen Degus in der Wildnis viele, kurze und gerade Trampelpfade an. Bei Degus ohne Feindeinwirkung fallen diese dagegen krummer und länger aus (Lagos et al. 1995). Ausserdem halten sich unter Feinddruck stehende Degus bevorzugt unter Sträuchern auf, um sich so vor Feinden zu schützen, während bei Ausschluss von Feinden die Degus vermehrt auf offenen Flächen weideten.
Degu Ratgeber online: http://degu.re4.ch/ratgeber/allgemeines_lebensweise.html (Stand: 31. Dez. 2007)