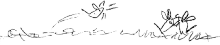Name und Verwandtschaft: Apereas oder Aperea-Wildmeerschweinchen (Cavia aperea) sind enge Verwandte des Tschudii-Meerschweinchens (Cavia tschudii), welches als Vorfahre des Hausmeerschweinchens (Cavia porcellus) gilt (Spotorno et al. 2004). Die Apereas gehören zur Familie der Meerschweine (Caviidae), welche wiederum zur Unterordnung der Stachelschweinverwandten (Hystricognatha) gehört (McKenna & Bell 1997; Novak 1991; Redford & Eisenberg 1992; Wilson & Reeder 2005).
Herkunft und Lebensraum: Apereas sind in Südamerika von Südost-Brasilien über Uruguay, Paraguay bis hin zu Nord-Argentinien verbreitet. Sie bewohen dort feuchte Savannengebiete (Asher et al. 2004). In Argentinien erreichen sie Populationsdichten von bis zu 38,7 Tiere/ha (Redford & Eisenberg 1992).
Aussehen: Apereas sind 20-32 cm lang, haben einen sehr kurzen oder gar keinen Schwanz und wiegen zwischen 450 und 800 g (Redford & Eisenberg 1992). Im Vergleich zu Hausmmerschweinchen sind sie etwa gleich gross, aber bedeutend schlanker und spitzschnäuziger. Das Fell weist ein Ticking auf (Agouti) und ist am Rücken dunkelbraun bis grau, am Bauch dagegen hellgrau gefärbt (Jordan 2001).
Lebensweise: Apereas sind tag- und dämmerungsaktive Pflanzenfresser (Cassini & Galante 1992; Redford & Eisenberg 1992) und leben in Gebieten, welche aus zwei verschiedenen Bereichen bestehen, Rückzugsgebiete, die aus hoher, dichter Vegetation bestehen und als Schutz gegen Feinde dienen und offene Gebiete mit kurzer Vegetation, welche den Apereas als Futter dient. Die offenen Gebiete werden nur zum Fressen betreten und durch stetige Unterbrüche beim Fressen und gelegentlichen Fluchten in die schützende Rückzugszone unterbrochen. Sie ernähren sich von Gräsern und deren Infloreszenzen, wobei sie sich nicht auf bestimmte Grasarten spezialisiert haben. Von Pampas-Apereas (Cavia aperea pamparum) ist allerdings bekannt, dass sie gerne Lolch (Lolium sp.) fressen (Asher et al. 2004; Guichón & Cassini 1998; Redford & Eisenberg 1992). Sie leben in stabilen, sozialen Gruppen, bestehend aus genau einem Männchen und 1-2 Weibchen, welche über Monate an einem festen Standort leben, den sie nur wechseln, wenn der Lebensraum zerstört wird oder ein Tier aus der Gruppe getötet wird. Zu anderen Gruppen haben sie wenig Kontakt und auch ihre Lebensräume überschneiden sich kaum. Sollte sich doch einmal ein Eindringling im Gebiet einer fremden Gruppe verirren, wird er spätstens dann von dem Männchen vertrieben, wenn er sich einem der Weibchen nähert. Aufgrund dieser klaren Abgrenzung gegen andere Gruppen markieren die Männchen auch keine Reviere, sie markieren aber ihre Weibchen mittels Analdrüsen (Asher et al. 2004). Da Apereas keine Baue graben, sind sie auf hohe und dichte Vegetation angewiesen. Dort bilden sie, versteckte, tunnelähnliche Pfade durch die Vegetation mit 8-12 cm Durchmesser. Sie haben keine festen Ruhe- und Schlafplätze. Gegen Feinde reagieren sie mit Erstarrung und ausharren in einer bewegungslosen Haltung, um so von Feinden nicht entdeckt zu werden (Asher et al. 2004; Cassini 1991; Cassini & Galante 1992; Redford & Eisenberg 1992).
Sonstiges: Hausmeerschweinchen gehören zu den ältesten domestizierten, südamerikanischen Heimtiere, welche etwa vor 3000 Jahren domestiziert wurden (Gade 1967; Herre & Röhrs 1990). Sie werden von den Indios in den Anden seit Generationen als Fleischquelle gezüchtet und zumeist in Hütten gehalten (Gade 1967).
Name und Verwandtschaft: Die Gattung der Chinchillas oder Wollmäuse umfasst neben den Langschwanz-Chinchillas (Chinchilla lanigera) noch eine weitere Art, das Kurzschwanz-Chinchilla (Chinchilla brevicaudata). Sie gehören zur Familie der Chinchillas (Chinchillidae) (Redford & Eisenberg 1992).
Herkunft und Lebensraum: Chinchillas lebten einst zahlreich in Chile, Argentinien und Peru. Durch die starke Jagd bis anfangs des 20. Jahrhunderts wurden sie nahezu ausgerottet. Langschwanz-Chinchillas kommen im Küstengebirgen und am Fusse der Anden vor. Kurzschwanz-Chinchillas dagegen kommen vorwiegend in der Puna, einer Hochebene der Anden vor und leben daher nördlicher und in höheren Lagen, als ihre Verwandten (Cofre & Marquet 1999; Redford & Eisenberg 1992).
Aussehen: Chinchillas haben einen kompakten Körperbau, einen kurzen Hals, der den Eindruck erweckt, dass Kopf und Rumpf eine Einheit bilden. Die Augen sind sehr gross, die Ohren sind länglich, abgerundet und überragen deutlich den Kopf. Dieser ist rundlich und weist eine kantige, aber abgeflachte Schauze auf. Das Fell ist auf der Oberseite silbergrau, am Bauch, um die Augen und Ohren weisslich. Der Schwanz ist lang und buschig und wird oft eingerollt.
Lebensweise: Chinchillas sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie ernähren sich von strikt pflanzlicher, karger Kost und fressen Kräuter, Sträucher und Sukkulenten (Cortés et al. 2002). Sie leben gesellig und bilden Kolonien von teilweise mehreren Hundert Tieren. Durch die beinahe Ausrottung umfassen viele Kolonie bloss noch wenige Tiere (Jiménez 1995).
Sonstiges: Chinchillas werden seit Jahrzehnten erfolgreich als Pelztiere gezüchtet. In Gefangenschaft werden sie oftmals hauptsächlich mit Pellets ernährt, welche aber genauso wie bei Degus als Futter in grösseren Mengen ungeeignet sind und zu gesundheitlichen Schäden wie Zahnproblemen führen können.
Name und Verwandtschaft: Neben der hier beschriebenen Art Abrocoma benetti gibt es mit Abrocoma cinerea noch eine weitere bekannte Art. Die Einordnung der Chinchillaratten ist umstritten. Zwar ordnen sie die meisten Autoren in eine eigene Familie, die Abrocomidae ein, einige zählen sie aber auch zur Familie der Trugratten.
Herkunft, Lebensraum: Chinchillaratten leben im nördlichen Mittelchile und kommen dort vom Meer bis in Höhen von 2000 m vor. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Copiapó hinunter bis zum Río Bío-Bío (Redford & Eisenberg 1992). Sie bevorzugen dabei felsiges Gelände mit Dickicht.
Aussehen: Sie sind etwa zwischen 15 und 25 cm lang. Der Schwanz ist nicht ganz so lang. Er hat einen runden Querschnitt und ist gut behaart. Wie bei den Degus haben auch Chinchillaratten an den Vorderfüssen 4 und an den Hinterfüssen 5 Finger, welche mit steifen, langen Haaren überwachsen sind, die teils gar die schwach gebauten Nägel überdecken.
Lebensweise: Chinchillaratten sind nachtaktiv. Sie bewohnen oft Höhlen, die von anderen Nagetieren gegraben wurden. Auch wurden sie schon zusammen mit Degus im selben Bau gefunden, wo sie sogar gemeinsam mit den Degus ihren Nachwuchs aufzogen (Fulk 1976). Ihre Nahrung ist herbivore und besteht vorwiegend aus Blättern. Unter anderem ernähren sie sich in grösseren Mengen von Chenopodium (Fuchsschwamzgewächse).
Sonstiges: Ihr Name haben sie vermutlich ihrem langen, weichen und dichten Fell zu verdanken, welches dem der Chinchillas ähnelt und auch manchmal in Pelzmärkten verkauft wird, obwohl es nicht so begehrt ist, wie das von echten Chinchillas.
Namen: Sumpfbiber, Coypu, Nutria oder Biberratte
Herkunft, Lebensraum: Der Sumpfbiber stammt aus Südamerika. Seine Verbreitung reicht von Mittelbolivien und Südbrasilien bis Feuerland.
Lebenserwartung: 6 Jahre, 12 Jahre
Aussehen: Sumpfbiber haben einen plumpen Kopf, kleine, runde Ohren und lange Schnurrhaare. Die Beine sind kurz. Die Hinterfüsse sind viel länger als die Vorderfüsse und haben 5 Zehen. Die ersten Vier sind mit Schwimmhäuten verbunden, der Fünfte ist frei. Die Vorderfüsse haben vier lange und flexible Finger ohne Schwimmhäute und einen verkümmerten Daumen. Sie sind zwischen 43 und 63 cm lang, ihr Schwanz misst weitere 30 bis 40 cm und wiegen 7 bis 9 kg. Männchen sind allgemein grösser als Weibchen. Sumpfbiber haben breite Schneidezähne, welche auf der Frontseite mit einer harten, orangefarbenen Schutzschicht überzogen sind. Ihr Fell besteht aus zwei verschiedenen Haartypen: einer weichen, dunkelgrauen und dichten Unterwolle, welche letztlich auch für die Pelzgewinnung begehrt ist, überdeckt mit langen, groben Grannenhaare.
Lebensweise: Sumpfbiber sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie leben in Gruppen von 2 bis 13 Tiere, welche sich aus verwandten erwachsenen Weibchen, deren Nachwuchs und einem grosses Männchen zusammensetzen. Junge erwachsenen Männchen leben gelegentlich auch als Einzelgänger. Sumpfbiber haben sich an die Lebensweise im und am Wasser angepasst und sind daher ausgezeichnete Schwimmer und können beim Tauchen über 10 Minuten lang unter Wasser bleiben. Den grössten Teil ihrer Zeit verbringen sie mit Nahrungssuche und fressen, Körperpflege und schwimmen. Sie sind Pflanzenfresser und ernähren sich grösstenteils von Bestandteile von Sumpf- und Wasserpflanzen, wie Halme, Blätter, Wurzeln und Rinde.
Fortpflanzung: Die Sumpfbiber-Mutter hat 12 Zitzen. Die Tragzeit liegt etwa zwischen 127 und 139 Tage. Die Wurfgrösse variiert zwischen 1 und 13 (Durchschnitt 3 bis 6) Junge, welche mit offenen Augen und komplett behaart zur Welt kommen. Sie wiegen bei Geburt etwa 225 g. Mit 3 bis 4 Tage nehmen sie die erste Nahrung selbstständig auf. Sie werden etwa mit 3 bis 7 Monate geschlechtsreif.
Sonstiges: Der Name Nutria kommt aus dem Spanischen und bedeutet eigentlich "Fischotter".
Degu Ratgeber online: http://degu.re4.ch/ratgeber/allgemeines_verwandtschaft.html (Stand: 31. Dez. 2007)