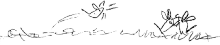Die Gattung der Strauchratten (Octodon) lässt sich in vier
Arten unterteilen.
Ihr Lebensraum erstreckt sich vom 28. bis 40. südlichen Breitengrad (Saavedra & Simonetti 2003).
Der Octodon degus ist am weitesten verbreitet. Sein Gebiet reicht von Husaco in der Provinz Atacama im Norden, um den 28. südlichen Breitengrad, bis nach Curicó im Süden, um den 35. Breitengrad (Contreras et al. 1987). Es erstreckt sich von den Küstenregionen bis 1200 Meter Höhe, ins Gebirge. Er bewohnt offene Steppenlandschaften, kann aber als Kulturfolger gut in der Nähe von Mensch und kultiviertem Ackerland leben und dort landwirtschaftliche Fressschäden verursachen. Er gilt daher in einigen Regionen als Schädling (Woods & Boraker 1975). Er ist ausserdem die kleinste Art unter den vier Deguarten (Hutterer 1994; Woods & Boraker 1975). Sein Fell ist auf der Oberseite agoutifarben und auf der Unterseite beige. Er hat ausgeprägte, helle gelb-beige Augflecken und Ohrmarkierungen. Sein Schwanz trägt eine dunkle ausgeprägte Quaste (Hutterer 1994). Er hat eine Gesamtlänge von 200-307 mm, eine Schwanzlänge von 81-138 mm und wiegt 195 g (Bozinovic 1992; Hutterer 1994).
Der Octodon bridgesi lebt vor allem am Fusse der Anden. Sein Gebiet erstreckt sich von der Provinz Cachapoal etwa vom
34 bis in die Provinz Malleco, 38 Grad südlicher Breite auf der westlichen Seite der Anden (Contreras et al. 1987). Damit ist er die am südlichsten
vorkommende Degu-Art, mal abgesehen vom Octodon pacificus. Er ist nachtaktiv und bewohnt feuchtere und buschigere Landstriche als O. degus (Contreras et al. 1987). Seit einiger Zeit ist allerdings bekannt, dass es auch Exemplare gibt, die auf der anderen Seite der Anden in Argentinien leben. Verzi und Alcover (1990) konnten 8 Exemplare in der Provinz Neuquén (Argentinien) fangen. Von den dort lebenden O. bridgesi ist bekannt, dass sie Höhlen bewohnen, die sich in Erdhügeln befinden und dadurch vermutlich gegen starke Regenfälle und Überflutung geschützt sind. Die Hügel befinden sich in Nothofagus-Wäldern und werden von Pflanzen der Gattung Chusquea sp. bewachsen. Ob diese Höhlen von den O. bridgesi selber gegraben werden oder ob sie bereits gegrabene Baue übernehmen ist nicht bekannt (Verzi & Alcover 1990).
Octodon bridgesi hat ein weicheres Fell als O. degus, welchem ausserdem das Tipping (die hellbraune Fell-Bänderung) fehlt. Ihm fehlen des weiteren die hellen Markierungen um die Augen und Ohren. Seine Ohren sind kurz, der Schwanz dagegen ist relativ lang und es fehlt ihm die buschige, pinselförmige Quaste (Hutterer 1994). Er hat eine Gesamtlänge von 250-370 mm, eine Schwanzlänge von 102-167 mm und wiegt 176 g (Bozinovic 1992; Hutterer 1994).
Der Octodon lunatus bewohnt das Küstengebirge entlang den küstennahen Streifen zwischen
dem 31. und 33. Breitengrad (Contreras et al. 1987) und die Gebirge um die Stadt Santiago (Saavedra & Simonetti 2003).
Sowohl Woods und Boraker (1975), als auch Contreras et al. (1987) erwähnen, dass Octodon lunatus äusserlich kaum vom Octodon bridgesi zu unterscheiden sei und der einzige Unterschied eine Furche im hintersten oberen Backenzahn die beiden Arten unterscheiden liesse.
Hutterer (1994) weist dagegen darauf hin, dass Octodon lunatus und O. bridgesi sehr wohl morphologisch unterscheidbar seien. Gemäss Hutterer sieht er dem O. degus ähnlich. Er weist ebenso ein agoutifarbiges Fell mit der typischen Bänderung auf, besitzt ebenso eine auffällige Quaste und die ausgeprägten Fellzeichnungen um Augen und Ohren. Das Fell sei allerdings länger und etwas weicher. Der Küsten-Degu hat eine Gesamtlänge von 328-382 mm, eine Schwanzlänge von 152-161 mm und wiegt 173 g (Bozinovic 1992; Hutterer 1994).
Der Octodon pacificus lebt auf der Isla Mocha (ca. 74. Längengrad, 38. Breitengrad), eine Insel im Pazifik vor der Küste von Chile, in der Nähe der Stadt Temuco. Die Art bewohnte vermutlich einst den valdivianischen Wald, welcher früher einmal die ganze Insel bedeckte (Saavedra et al. 2003). Die Art ist auf der Roten Liste als gefährdet (VU: vulnerable) eingestuft. Saavedra et al. (2003) konnten bei einer grossflächigen Fangaktion kein einziges Exemplar fangen, was möglicherweise bedeuten könnte, dass diese Art ausgestorben ist. Da aber die Berggebiete nicht untersucht wurden, ist nicht auszuschliessen, dass es möglicherweise dort noch wenige überlebende Arten geben könnte. Da dieses Gebiet aber sehr klein ist, wäre das Überleben dieser Art dennoch bedroht. Die Ursache für den Rückgang dieser Art sind die Zerstörung der für den O. pacificus wichtigen Wälder, aber auch eingeschleppte Arten wie z. B. die Wanderratte (Rattus norvegicus). Das Fell des Pazifik-Degus ist einfarbig ohne typische Bänderung, die Ohren sind kurz. Der Schwanz ist lang und weist keine ausgeprägte Quaste auf. Das Fell ist ausserdem weicher als das des O. degus (Hutterer 1994). Anhand von zwei Exemplare gibt Hutterer (1994) eine Gesamtlänge von 380 bzw. 390 mm, eine Schwanzlänge von 170 bzw. 165 mm und ein Gewicht von je 290 g an.
Thomas und Yepes anerkannten zwei Unterarten, den Flachland-Degu O. d. degus und den Hochland-Degu O. d. clivorum. Ellermann soll sogar fünf Unterarten anerkannt haben. Osgood kam bei einer grossen Serie an Untersuchungen zum Schluss, dass es keine Unterarten gebe (Woods & Boraker 1975). Diese Untersuchungen stützten letztlich auch die Meinung von Woods & Boraker, welche in ihrer Monographie keine Unterarten anerkennen; eine Meinung, die sich so durchsetzen konnte.
Mettler (1995) prägte die Ansicht, dass es zwei Degutypen gäbe, die bei unseren Degus beobachtbar seien. Einen kleineren, gedrungeneren Typ mit dunklen Ohren und einen grösseren, aktiveren Typ mit helleren Ohren. Der kleinere Typ soll im Vergleich zum grösseren keine so ausgeprägte typische Augflecken und Ohrmarkierungen aufweisen.
Der kleinere Typ entstamme von Importe der 70er Jahren, die in den Tierpark Berlin-Friedrichsfelde gelangt seien. Der grössere Typ dagegen soll erst in den 90er Jahre in Europa aufgetaucht sein. Ein weiterer Typ soll von den Farben her dem ersten, von den Proportionen her aber dem zweiten Typ ähneln. Da inzwischen bei vielen Degus die Merkmale dieser beiden Typen vermischt sind, mutmassen Sporon und Mettler (2002), dass die beiden Typen inzwischen vermischt wurden.
Als Erklärung für diese Unterschiede zieht Mettler mehrere Möglichkeiten in Betracht, es könne sich um Tiere verschiedener Arten oder Unterarten, Populationen oder Zuchtstämme handeln. Dass es sich bei den ersten beiden Typen um verschiedene Arten (z.B. O. degus und O. bridgesi) handeln könnte ist eher unwarscheinlich. Dazu widersprechen die Beschreibungen der beiden Arten denen der beiden Typen. Der O. degus ist die kleinste Deguart und wäre diesbezüglich dem ersten Typen ähnlich. Er besitzt aber dagegen die auffälligen Zeichnungen um die Augen und Ohren, welche dem ersten Typen fehlen. Dagegen wäre durchaus denkbar, dass der kleine gedrungene Typ durch intensive Linienzucht geprägt wurde, wie dies auch von Sporon und Mettler (2002) in Erwägung gezogen wird.
Der Begriff Degu wird in der Regel als Synonym für den gewöhnlichen Degu (Octodon degus) verwendet. Wird eine andere Deguart gemeint, so wird dies in der Regel auch erwähnt. Grund dafür ist sicher die weite Verbreitung des gewöhnlichen Degus und die Vermutung, dass vermutlich der grösste Teil der in Gefangenschaft gehaltenen Degus zu dieser Art gehören. Ebenso werden die Deguarten zusammenfassend als Degus bezeichnet. Der Begriff Strauchratte, der eigentlich im Deutschen für die Gattung Octodon steht, wird dagegen eher selten verwendet. Der Name ist wohl ein Relikt aus vergangener Zeit. Noch vor hundert Jahren waren Tierbezeichnungen, die mit Ratte oder Maus gebildet wurden, keine Seltenheit. So bezeichnet Stange (1914) in seinem Werk über Chile den Degu als "Mauerratte". Ein Begriff der inzwischen ausgestorben ist, wie viele andere alte Bezeichnungen auch.
Neben den naturfarbenen Degus mit Agouti-Fellzeichnung gibt es inzwischen auch bereits erste gezüchtete Farbmutationen. Bedauerlich bei solchen Mutationen ist, dass vielmals zu sehr auf Farbe selektiert wird, dass auch mit Tieren gezüchtet wird, die bei einer verantwortungsvollen Zucht längst aus der Zucht genommen würden. Schon bei anderen Heimtieren hat es sich gezeigt, wo eine solche Zucht hinführen kann, wenn Charakter und Gesundheit der Zuchttiere bei der Selektion vernachlässigt werden. Die Folgen sind meist assoziale, kränkliche Zuchtlinen, die sich stark von den ursprünglich domestizierten Wildtieren unterscheiden. Da dieser Prozess nur langsam abläuft, machen sich solche Entwicklungen meist erst sehr spät bemerkbar.
Einer der ersten Farbschläge waren die blauen Degus (auch Silber Degus genannt), deren Fell einen leichten blauen Schimmer hat. Der Unterschied zu agoutifarbenen Degus ist vor allem im Kindesalter feststellbar. Einen weiteren Farbschlag stellen die sandfarbenen Degus dar. Bei den sandfarbenen Degus sind im Gegensatz zu den gewöhnlichen agoutifarbenen Degus eindeutige Nachteile ersichtlich. Diese Degus unterscheiden sich durch ein viel ruhigeres, fast schon teilnahmsloses Wesen und wirken zudem bedeutend weniger vital. Möglicherweise sind sie auch krankheitsanfälliger und haben eine kürzere Lebenserwartung. Da sie kein agoutifarbenes Fell haben, fehlt ihnen eines der markantesten Merkmale, die einen Degu ausmachen. Glücklicherweise sind solche Degus bei uns noch kaum verbreitet. Dagegen verbreiten sich leider in der letzten Zeit vermehrt gescheckte Degus. Im Gegensatz zu den blauen Degus unterscheiden sie sich bereits einiges deutlicher von den wildfarbenen Degus und es scheint, dass hier intensiv auf Farbmerkmale vermehrt wird und andere Selektionskriterien aufgrund der grossen Nachfrage ausser Acht gelassen werden. Eine gefährliche Entwicklung, auch wenn sich die Folgen vermutlich erst in ein paar Jahren bemerkbar machen werden.
Neben diesen Mutationen gibt es Gerüchte über vereinzelt auftretende weisse und schwarze Degus. Über die Existenz von Albinos ist mir zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt, noch ob sowas theoretisch überhaupt auftreten könnte. Zumal bei einigen andern Kleinsäugern trotz der Zucht von Tieren mit roten Augen keine echten Albinos gezüchtet werden konnten.
Hinweis zur Grafik:
Die Grafik basiert auf den oben im Text beschriebenen Verbreitungsangaben. Sie ist daher nicht besonders genau und erhebt auch keinen Anspruch auf Richtigkeit, sondern soll bloss den Text hier visualisieren.
Ich möchte an dieser Stelle noch auf Saavedra & Simonetti (2003) Fig. 2 verweisen, eine genauere Grafik über die Verbreitung der vier Deguarten.
Degu Ratgeber online: http://degu.re4.ch/ratgeber/allgemeines_deguarten.html (Stand: 31. Dez. 2007)